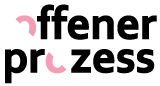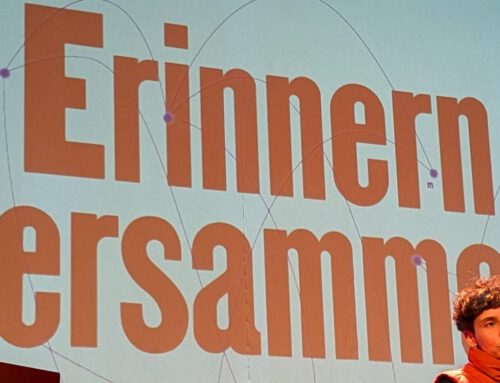Wie weiter? Das war die zentrale Frage auf dem Podium am 22. Februar 2019 in der Werkstatt der Kulturen in Berlin, zu der die Organisator*innen des Tribunals ‚NSU-Komplex auflösen‘ eingeladen haben. Ein breit aufgestelltes Podium versuchte sich vor dem Hintergrund des im Juli 2018 beendeten NSU-Prozesses in München einer Antwort anzunähern.
Auf die Folgen des Urteils im NSU-Prozess verwies Mitat Özdemir von der IG Keupstraße aus Köln. Er zeigte sich sehr enttäuscht vom Urteil: „3. Bombe – das ist die richtige Bezeichnung für das Urteil“, erklärte Özdemir. Die Erwartungen an den Prozess seien in nicht erfüllt worden, die Menschen auf der Keupstraße würden weiter auf Gerechtigkeit warten und auch die Angst bestehe weiterhin fort. Allerdings gibt es auch Anlass für Hoffnung, die etwa durch Initiativen „Kein Schlussstrich“ gestärkt werde. Özdemir betont zudem, dass es endlich ein Denkmal braucht, „das wirklich nachhaltig ist.“
Eben jenes Mahnmal, das Ulf Aminde für die Keupstraße entworfen hat und mit dem das Ziel verknüpft ist, nicht nur zurück, sondern auch „proaktiv nach vorne zu schauen.“ Nach Wettbewerb stagniere jetzt aber die Umsetzung der Pläne. „Die Stadt setzt sich nicht für uns ein“, erklärt Aminde, außerdem wollen am anvisierten Ort Investor*innen eine Bebauung umsetzen, die keinen Raum für das Mahnmal vorsieht. Er kritisiert zudem das vorgesehene Entwicklungs- und Umsetzungsbudget der Stadt Köln von gerade einmal 50.000 Euro. Das Mahnmal solle aber „kein Ablassobjekt und nicht irgendeine Plakette“ sein. Insofern ist es nur folgerichtig, wenn Mitat Özdemir darauf hinweist, dass hier gesellschaftlicher Druck nötig sein wird:
„Wir wollen das Denkmal in der Keupstraße. Dafür brauchen wir eine riesengroße Demonstration. Ich wünsche mir, dass die Leute von überall nach Köln kommen, um zu demonstrieren. Dass ihr alle da seid.“
Auch der Vertreter der Nebenklage Alexander Hoffmann kritisierte den Urteilsspruch in München. Mit keinem Wort sei das Gericht auf die Perspektive der Betroffenen eingegangen. Es habe allein die These der Bundesanwaltschaft aufgegriffen, wonach der NSU „eine isolierte Gruppe von drei Leuten“ gewesen sei. So konnte von vorneherein nur ein falsches Urteil entstehen. Abgeschlossen sei damit auch das Kapitel juristische Aufarbeitung, Aufklärung sei hier nicht mehr zu erwarten.
Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemtischer Gewalt knüpft hieran an: „Wenn wir jetzt über Aufklärung reden, müssen wir in andere Arenen gehen.“ Dort sei nicht unbedingt schön, aber man müsse jetzt nach Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern schauen. Kleffner verweist auf die journalistischen Recherchen, die die Verbindung zwischen dem NSU und Nürnberg neu ausleuchten oder betont den nachgewiesene Kontakt zwischen Ralf Marschner und dem NSU-Kerntrio, der bisher folgenlos geblieben sei. „Wir müssen uns selbst ernst nehmen und darauf bestehen, dass das Konsequenzen hat.“ Zudem gehe es gerade vor dem Hintergrund rassistischer Angriffe in Sachsen nach wie vor darum, „die Gräben und Sprachlosigkeit mit den Betroffenen rechter Gewalt“ zu überwinden.
Für die Projekte der Geschichtswerkstätten aus Chemnitz, Zwickau und Jena saß Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen auf dem Podium. Er betonte, dass man nicht aufgegeben werde. Das habe auch damit zu tun, so Starosta selbstkritisch, dass „wir uns noch immer dafür schämen, dass wir auf die dilettantische Berichterstattung in den Medien und die Aussagen der Polizei zur Ceska-Mordserie hereingefallen sind“. Zugleich sei es wichtig, der sich neu formierenden sozialen Bewegung von rechts entgegenzutreten.
Ibrahim Arslan, Überlebender des rassistischen Brandanschlags von Mölln, hob hervor, dass es darum gehen müsse, die Perspektive der Betroffenen in den Vordergrund zu rücken. Es brauche Räume, in denen Betroffenen zugehört wird. Es brauche eine Gesellschaft, die zuhört. Die materielle Ebene dürfe dabei aber auch nicht vernachlässigt werden: Wahlrecht und Hilfe bei der Vermittlung von Jobs sind ebenso wichtig, um Betroffenen rassistischer Gewalt Perspektiven zu eröffnen. Zudem sei es äußerst wichtig, dass die Betroffenen rassistischer Gewalt in Gedenkdiskussionen einbezogen werden: „Sie sollen entscheiden, wie ein Gedenken aussehen soll.“
Die Veranstaltung in Berlin hat eindrucksvoll deutlich gemacht, dass die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex nicht beendet werden kann. Mitat Özdemir hat Recht, wenn er fordert: „Wir müssen groß denken. Auch damit wir den Familien der Opfer Mut geben!“